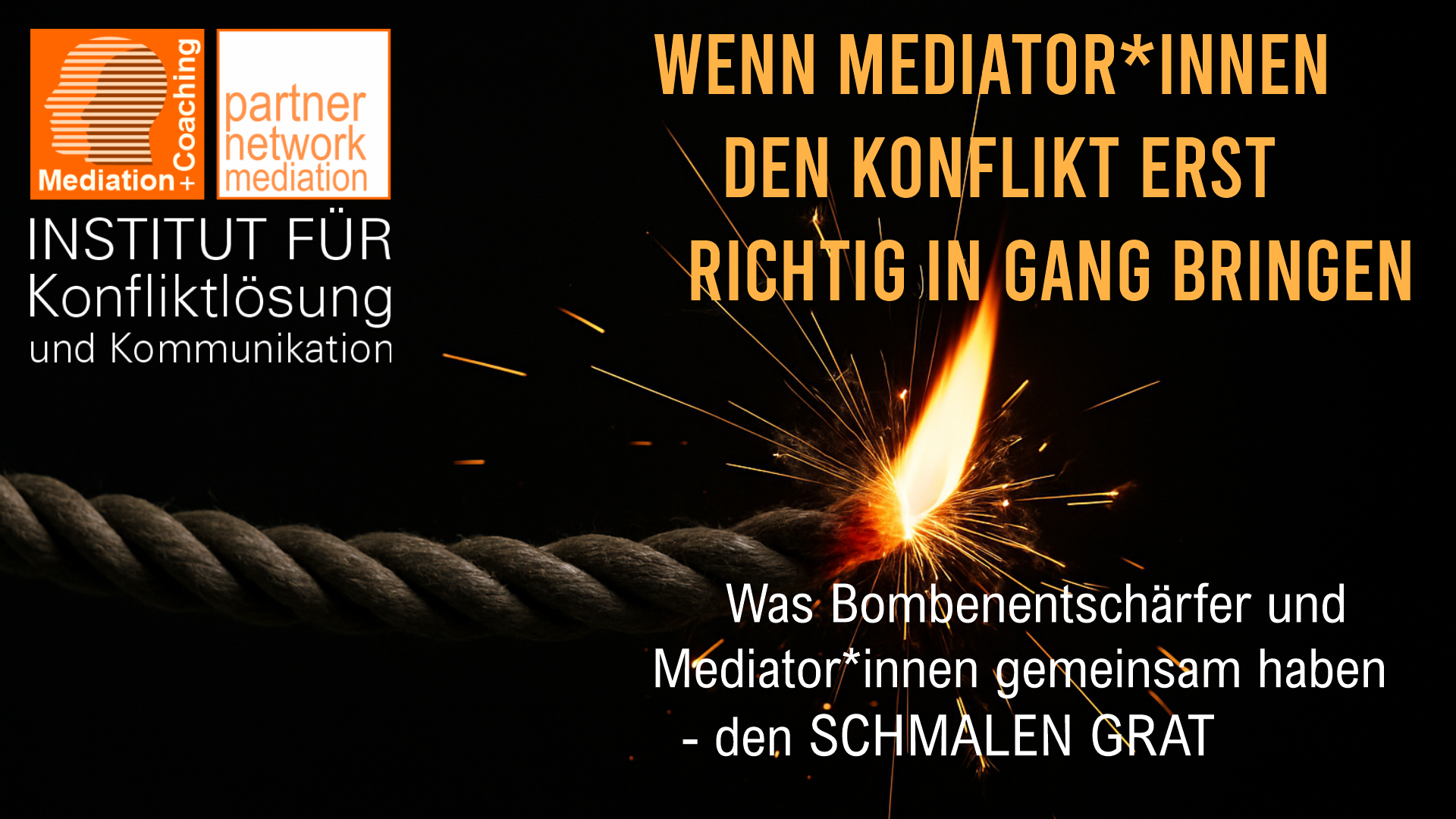„Nicht jeder Konflikt muss geklärt werden.“ Dieser Satz, beiläufig in einer kollegialen Runde geäußert, wirkt auf den ersten Blick fast provokant. Denn in der Welt der Mediation gilt Klärung als oberstes Gebot. Konflikte sollen benannt, verstanden, bearbeitet werden – am besten vollständig und nachhaltig.
Doch bei genauerem Hinsehen ist die Frage berechtigt: Wann wird Klärung zur nervenden Überforderung – und wann erzeugen wir durch Klärung erst den eigentlichen Konflikt?
Frühintervention oder Frühverhärtung?
Gerade auf niedrigen Eskalationsstufen (nach Glasl¹) kann ein Konflikt eher ein Kommunikationssignal als eine Störung sein. In diesen Phasen greifen manche Mediator*innen vorschnell zu Werkzeugen, die eigentlich für tiefere Konflikte gedacht sind. Das kann zu einem paradoxen Effekt führen: Durch die formale Bearbeitung bekommt der Konflikt erst eine institutionelle Realität – er wird verobjektiviert und damit stabilisiert.
Was vorher ein Missverständnis oder eine Irritation war, wird plötzlich zu einer „Sache“. Friedrich Glasl beschreibt diesen Übergang treffend als Verhärtung: Ein Spannungszustand, der erst durch Benennung zur Existenz gelangt.¹
Duss-von Werdt: Konflikte sind Konstruktionen
Der Schweizer Mediationsforscher, Pfarrer und Philosoph Josef Duss-von Werdt erinnert daran, dass „Wirklichkeit“ immer eine soziale Konstruktion ist.² Damit gilt auch: Ein Konflikt ist keine objektive Gegebenheit, sondern das Ergebnis einer Zuschreibung. Das bedeutet, Mediator*innen gestalten Wirklichkeit, sobald sie den Konflikt benennen, rahmen oder methodisch bearbeiten.
Wenn wir also vorschnell „in die Klärung gehen“, schaffen wir eine Wirklichkeit, die ohne unsere Intervention vielleicht gar nicht so massiv geworden wäre. Duss-von Werdt spricht in diesem Zusammenhang von einer reflexiven Mediation – einer Haltung, die sich selbst und ihre Wirkung mitdenkt.
Systemische Perspektive: Nicht jedes System braucht Intervention
Aus systemtheoretischer Sicht (Luhmann³) gilt: Ein soziales System reguliert sich durch Kommunikation – und zwar selektiv. Nicht jedes kommunikative Problem verlangt also nach externer Intervention. Manchmal genügt es, dass das System „störungsresistent“ bleibt und den Konflikt als Unterschied, der keine Differenz macht integriert.
Ein vorschnelles Eingreifen kann dagegen Selbstorganisationsprozesse stören. In Organisationen erleben wir das, wenn Führungskräfte oder Mediator*innen „Frieden herstellen“ wollen, obwohl der Konflikt funktional ist – etwa als Ventil für unausgesprochene Spannungen oder als Impuls für Veränderung.
Watzlawick und die paradoxe Wirkung von Klärung
Paul Watzlawick formulierte in seiner „Anleitung zum Unglücklichsein“ das Prinzip des paradoxen Handelns:
„Je stärker man etwas erzwingen will, desto sicherer verhindert man es.“⁴
Übertragen auf Mediation bedeutet das: Wer um jeden Preis Klärung will, riskiert Verhärtung. Ein Zuviel an Struktur, Sprache oder Technik kann die Beteiligten von der spontanen Selbstregulation des Systems abhalten.
Gerade in Teams oder Familien, in denen Beziehungsebene und Rollenebene eng verwoben sind, kann das Streben nach „Klärung“ eine Überforderung darstellen – emotional wie kommunikativ.
Zwischen Toleranz und Verdrängung
Natürlich heißt das nicht, Konflikte zu ignorieren oder schönzureden. Aber Konfliktkompetenz zeigt sich nicht darin, jeden Konflikt zu bearbeiten, sondern zu erkennen, welche Konflikte einer Bearbeitung zugänglich sind – und welche durch Zeit, Distanz oder bewusste Nicht-Intervention besser ausklingen.
Das erfordert eine Haltung der Gelassenheit: Aushalten statt aufarbeiten. Beobachten statt bewerten.
Professionalisierung: Klärung braucht Urteilskraft
Genau darin liegt die Herausforderung – und zugleich die Parallele zu den Bombenentschärfer*innen: Beide arbeiten mit Zündstoff. Beide müssen wissen, wann sie sich nähern dürfen – und wann nicht.
Darum ist eine fundierte Ausbildung so entscheidend – eine, die nicht nur Methoden vermittelt, sondern auch die Fähigkeit, Nicht-Tun als Option zu begreifen.
In den aktuellen Diskussionen – etwa im Bundesverband zertifizierter Mediator*innen (BzM e. V.) – geht es genau darum: nicht nur mediative Techniken zu lehren, sondern professionelle Urteilskraft zu entwickeln.
Denn mediative Kompetenz zeigt sich nicht in der Anzahl der eingesetzten Methoden, sondern in der Haltung der Mediator*innen und im Bewusstsein, wann Eingreifen hilfreich ist – und wann Schweigen stärker wirkt als jedes Werkzeug.
Vom Klärungszwang zur Konfliktintelligenz
Vielleicht ist das die reifere Form mediativ-systemischer Kompetenz: Nicht aus jedem Unterschied sofort einen Konflikt zu machen. Nicht jedes Unbehagen als „Thema“ zu pathologisieren. Und vor allem: nicht immer eingreifen, nur weil man es kann, oder meint, es zu können.
Denn manchmal ist es nicht der Konflikt selbst, der gefährlich wird – sondern der Moment, in dem wir glauben, ihn unbedingt entschärfen zu müssen.
Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich freue mich über Gedanken, Widerspruch oder Ergänzungen – denn genau darin liegt die Qualität unseres Fachdialogs.
Interessante Links
- Was ist denn eine Mediation? Schnell erklärt. (Youtube-Film)
- Für wen kommt eine Mediation in Frage?
Familien, Nachbarn und Vereine
Betriebs- und Personalräte, Arbeitnehmervertretungen
Unternehmen, Verwaltungen, Führungskräfte
Literatur
(1) Glasl, Friedrich (2013): Konfliktmanagement – Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater. Bern: Haupt Verlag.
(2)Duss-von Werdt, Josef (2017): Mediation als Verfahren und Haltung. Zürich: SKWM Verlag.
(3)Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
(4)Watzlawick, Paul (1983): Anleitung zum Unglücklichsein. München: Piper Verlag.